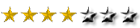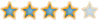D'accordo, also hier mein erster Post. Den kann man gerne als Template nehmen, erhöht vielleicht die Lesbarkeit des Threads ^^
Anzahl Sprachen: aktuell 13, wenn ich mich nicht verzähle (Edit: hab mich verzählt, sind 12 ^^)
Sprache und KulturAus meiner Sicht hängen Sprache und Kultur unmittelbar zusammen, deswegen erstelle ich in der Regel vor der eigentlichen Entwicklung eine kurze Übersicht über die Sprecher; Religion, Verhalten, wichtige Punkte in der Geschichte, Rituale. Gerade für ursprüngliche Sprachen aus der Entstehungszeit erster Kulturen nehme ich das sehr ernst. Daraus ziehe ich dann Rückschlüsse auf den Wortschatz, auf die verfügbaren Geschlechter, wie man seine Umgebung überhaupt wahrnimmt (ist "Zeit" eine Eigenschaft der Handlung? Der realen Objekte? Gibt es Götter, wie wirken die sich nach Ansicht der Sprecher aus? Wonach kann man Objekte klassifizieren, ergo welche Geschlechter gibt es, und was für Eigenschaften (Kasus/Numerus/Attribute) haben sie?).
Bei Sprachen, die am Ende des Stammbaums in fortschrittlicheren Kulturen vorkommen, sehe ich das lockerer -- hier haben die Vorgängersprachen den größten Einfluss und die habe ich i.d.R. noch nicht geschrieben. Ein paar Eckpunkte, den Einfluss von umgebenden Sprachen und den Ursprung sowie die moralischen Vorstellungen der Sprecher schreibe ich normalerweise trotzdem extra auf (bzgl. umgebender Sprachen auch welche, die ich noch nicht erfunden habe, weil ich dann darauf zurückgreifen kann, wenn ich sie zu einem späteren Zeitpunkt konstruiere).
OrganisationInzwischen hat sich da bei mir ein relativ festes Vorgehen herauskristallisiert, das für mich ganz gut zu funktionieren scheint. Vielleicht hilft es auch jemandem, der zwar Lust auf das Erfinden hätte, aber nicht weiß, wo er anfangen soll.
1. Wie im ersten Abschnitt beschrieben: als erstes kommt meine Beschreibung der Kultur, als Basis für den Klang der Sprache, einen Grundwortschatz und die Grammatik.
2. Der Klang der Sprache und eine einheitliche Notation für die Laute/Diphtonge (die ich normalerweise an einer Schrift der Kultur ausrichte - insofern sie Buchstaben benutzt -, obwohl ich die Schrift nicht immer erfinde). Was Laute betrifft gibt es im Thread "Selbsterfundene Sprachen" einiges an Material, da gehe ich hier nicht näher auf ein.
3. Erste Klassifizierung der Grammatik und falls ich es vorhabe, Etablierung eines anderen semantischen Systems (bisher habe ich nur ein richtig anderes erfunden, vielleicht erzähle ich mal in einem anderen Post davon). Normalerweise bleibe ich aber bei unserer geläufigen Unterteilung in Substantive/Verben/Attribute. Eine, wie ich finde, für die Sprachkonstruktion ganz sinnvolle Typisierung ist die
klassische morphologische Typologie:
- agglutinierende Sprachen (Anhängen von grammatikalisch wichtigen Morphemen an den Wortstamm, d.h. Wortstamm bleibt gleich und Partikel oder Endungen werden vor- oder nachgeschoben)
- polysynthetische Sprachen (sehr viele bedeutungstragende Morpheme in einem Wort, viele indianische Sprachen können hier zum Vorbild genommen werden)
- flektierende Sprachen (der Wortstamm kann sich je nach grammatischer Funktion verändern, "Haus" => "Häuser")
- fusionale Sprachen (die grammatische Funktion bestimmt eine Endung, die dem Wortstamm angehängt wird, sind viele europäischen Sprachen inkl. Deutsch)
- analytische Sprachen (die grammatische Funktion bestimmt sich in erster Linie durch die Position im Satz; Mandarin ist ein gutes Beispiel dafür, aber auch Englisch ist mangels Fällen teils analytisch)
Wichtig: Die Typen sollen nur eine Grundlage sein, man kann sie insbesondere noch in einer Sprache vielfältig mischen. Aber es hilft zumindest mir, mich darüber klar zu werden, wie ich mit welchen Wortarten umgehen will, und erlaubt eine erste Konzeption der Sprache, noch bevor man sich im Detail an die Grammatik setzt.
4. An dieser Stelle fange ich dann mit der Grammatik an, wenn ich mir einigermaßen klar darüber geworden bin, wie die Sprache sich verhalten soll. D.h. wenn ich weiß, welche Wortarten ich gebrauche und was für eine Vorstellung von der Welt die Sprecher haben sollen. Ausgehend von einem klassischen Substantiv/Verb/Attribute-System:
4.1 Mein erster Punkt sind eigentlich immer die
Substantive. Wie möchte ich die Substantive in bsp. Geschlechter und Deklinationen einteilen? Was für eine Form sollen Substantive haben - immer feste Endungen, beliebige Formen, flektierender Wortstamm? Ist das Geschlecht am Aussehen ersichtlich oder muss es auswendig gelernt werden? Möchte ich Artikel haben und brauche ich Bestimmtheit für Substantive? Sollen sich Namen anders verhalten als gewöhnliche Substantive? Anschließend natürlich Kasus, Numeri, etc. und die genauen Regeln (z.B. Deklinationstabellen) ausarbeiten, die ich brauche, um jedes Substantiv in seine Form zu überführen.
4.2 Als nächstes kommen die
Verben. Wieder grundsätzliche Fragen: brauche ich einen Infinitiv/Partizipien? Wie unterscheidet man ein Verb von anderen Wortarten (kann durchaus einfach die Position im Satz sein)? Welche Zeiten soll es geben, brauchen die Sprecher Aspekte (Aorist, Vollendet, Unvollendet ...), sind die Verbformen stark oder brauche ich Hilfsverben (möglicherweise nur für bestimmte Formen)? Was für Modi (Konjunktiv, Konditionalis, Imperativ) will ich haben, wie viel wird einfach durch Adverben oder den Kontext ausgedrückt? Und natürlich: was gibt es für Personen, Numeri, Konjugationen ... Dann als letztes wieder Konjugationstabellen aufstellen oder was ich sonst brauche, um ein Verb in seine Formen zu überführen.
4.3 Dann kümmere ich mich um den Satzbau: S-P-O, S-O-P, ...? Brauche ich überhaupt einen festen Satzbau? Können die Satzglieder durch Partikel deutlich gemacht werden, kann der Satzbau mit der Art meiner Substantiven/Verben eindeutige Sätze bilden, brauche ich noch zusätzliche Partikel/Informationen dafür? Wo dürfen welche Adverben/Attribute hin? Wie sehen ein Aussagesatz, Fragesatz (Bedindungsfrage / inhaltsorientierte Frage), Ausrufesatz, Nebensatz aus? Habe ich andere Aussagen (z.B. Ironie), für die ich einen eigenen Satzbau möchte?
4.4 Das letzte für mich wirklich wichtige Thema sind dann Attribute (für sowohl den Satz global als auch auf einzelne Satzglieder bezogen); normalerweise Adjektive, Adverben, Präpositionalausdrücke, Relativsätze, satzwertige Konstruktionen. Hier bin ich in der Regel durch die vorherigen Ergebnisse schon soweit eingeschränkt, dass die passenden Lösungen auf der Hand liegen und ich sie mir relativ schnell aussuchen kann.
4.5 Nach den obigen Teilen sollte die Sprache im Prinzip komplett sein, d.h., alles was wir im Deutschen ausdrücken können, ließe sich dort den nötigen Wortschatz vorausgesetzt ebenfalls sagen. Im Anschluss kann man noch nach Bequemlichkeitskonstruktionen suchen; bsp. wann man das Subjekt weglassen darf, Substantivierungen, wo sich Ausdrücke verkürzen lassen, wie schreibt man indirekte Rede, historischer Präsens, etc. Hier ist es für mich am einfachsten, einfach mal deutsche Texte zu übersetzen und zu schauen, ob mir währenddessen solche Möglichkeiten auffallen.
Achtung: MMn sollte man auch die Grammatik nie als "fertig" betrachten. Wir haben auch im Deutschen viel mehr (teils nur umgangssprachliche) grammatische Konstruktionen/Abweichungen im Satzbau, als man denkt; wenn man eine Chance sieht, die Grammatik dahingehend um Ausdrucksstärke zu erwarten (wie gesagt, sei es nur für die Umgangssprache), würde ich sie ergreifen.
5. Das ist jetzt nicht wirklich der fünfte Schritt, eigentlich findet mein Ausbau des Wortsatzes immer gleichzeitig mit der Grammatik statt ^^ Aber da man mit dem Wortschatz nie wirklich fertig sein kann (meine erste Sprache ist inzwischen bei 3200 Vokabeln und ein paar hundert Redewendungen/festen Ausdrücken), packe ich sie mal ans Ende.
Ich fange immer erst dann mit dem Wortschatz an, wenn ich eine Ahnung habe, wie die Wörter/Wortstämme überhaupt aussehen dürfen und welche Zusatzinformationen wie Geschlecht oder unregelmäßige Formen ich möglicherweise mitangeben muss. Entsprechend erfinde ich die ersten Wörter meistens dann, wenn ich für sie z.B. Deklinations- und Konjugationstabellen anlegen muss; also wieder erst Substantive, dann Verben.
Anschließend verwende ich in den Grammatikregeln oft Beispielsätze, wofür ich dann eventuell weitere Worte erfinde. Wenn die wichtigen Teile der Grammatik abgeschlossen sind, setze ich mich (je nachdem, wie wichtig mir ein größerer Wortschatz gerade ist) ans Übersetzen von einfachen Texten (in der Regel erstmal ein kurzer Dialog zwischen Angehörigen der Sprecherkultur). Damit hat man einen Grundwortschatz, der ausreichen sollte, um sich noch an die Wortbildung zu erinnern, wenn man später irgendwann mit dem Ausbau fortfährt.
Falls ich ein Wort eintrage schaue ich außerdem oft nach Synonymen oder nahestehenden Begriffen, die ich ebenfalls als Bedeutung hinzufügen kann; teilweise auch Teekesselchen, wenn mir auf Anhieb welche einfallen. Soweit möglich schaue ich auch, ob ich einen Wortstamm von einem nahestenden Begriff ableiten kann (Lautverschiebung, Konkatenation, Verkürzung, Prä- und Suffixe).
FormatIch habe es ehrlich gesagt mit Zeichnen und Graphik nicht so, was nicht unerheblich daran liegt, dass ich darin einfach unbegabt bin

Dementsprechend sind meine Formate zum Speichern sehr einfach:
Zur
Kultur in der Regel ein mehr oder weniger kurzer Fließtext.
Schriftsysteme hatte ich noch in meinen ersten Sprachen, die ich old-fashioned auf Papier entworfen habe, auch konstruiert; da ich jetzt nur noch am PC arbeite, mache ich das meistens gar nicht mehr. Da ich schon das lateinische Alphabet nicht besonders ordentlich auf Papier bringen kann, tue ich mich mit den Entwürfen der Schriftzeichen sowieso schwer, obwohl ich es prinzipiell spannend finde ^^' Aus drei Schriften habe ich mittlerweile mit FontForge einen Font gebastelt, aber die sehen auch mehr schlecht als recht aus und werden irgendwann eine Überarbeitung brauchen ... (in meinem Profilbild ist übrigens eine Probe von "Martalem")
Der
Wortschatz entsteht einfach in drei Spalten einer Excel- (bzw. OpenOffice Calc-)Tabelle mit Bedeutung, Wort (mit Endung, Geschlecht oder anderen notwendigen Infos) und "Zusätzliches" (da kommt z.B. der Ursprung abgeleiteter Wörter rein, unregelmäßige Formen, die Aussprache, falls uneindeutig, und teils Nutzungsbeispiele). => Vorteile: Einfache Suche, OpenThesaurus unterstützt Synonymsuche, übersichtlich
Die
Grammatik trage ich der Einfachheit halber auch im Sheet mit dem Wortschatz ein (kurze Wege); das ist auch für etwaige Tabellen (wie von Deklinationen, Konjugationen, Steigerungsformen) praktisch. Ansonsten ist Grammatik so abwechslungsreich, dass weitere Formatvorschläge vermutlich unsinnig sind.
Viel mehr habe ich, glaube ich, gar nicht mehr zu schreiben ^^ Mit etwas Glück kann das für auch für jemand anderem von Nutzen sein :-)
Vielleicht noch eine Sache, an die ich mich oft selbst erinnere, um "abseits der Wege" zu denken: eine Sprache ist mehr als das, was man in der Schule lernt; letzten Endes zählt nur, dass man in ihr kommunizieren kann. Mir hilft es meistens, mich in meine Zielkultur hineinzuversetzen und mir zu überlegen, wie ihre Mitglieder die Welt wahrnehmen könnten, ganz ohne Begriffe wie "Substantive, Verben, Objekte, S-P-O". Gerade für ursprüngliche Sprachen mMn sehr wichtig, damit sie nicht von den eigenen Vorstellungen durch reale Sprachen beeinflusst werden. Oder man nimmt sich explizit vor, mindestens eine Konvention einfach zu brechen (muss die Zeit denn immer durch das Verb ausgedrückt werden? Kann man nicht genausogut sagen, dass ein vergangener Zustand des Subjekts handelt?)
Das als Abschlusswort

Viele Grüße
Neclus